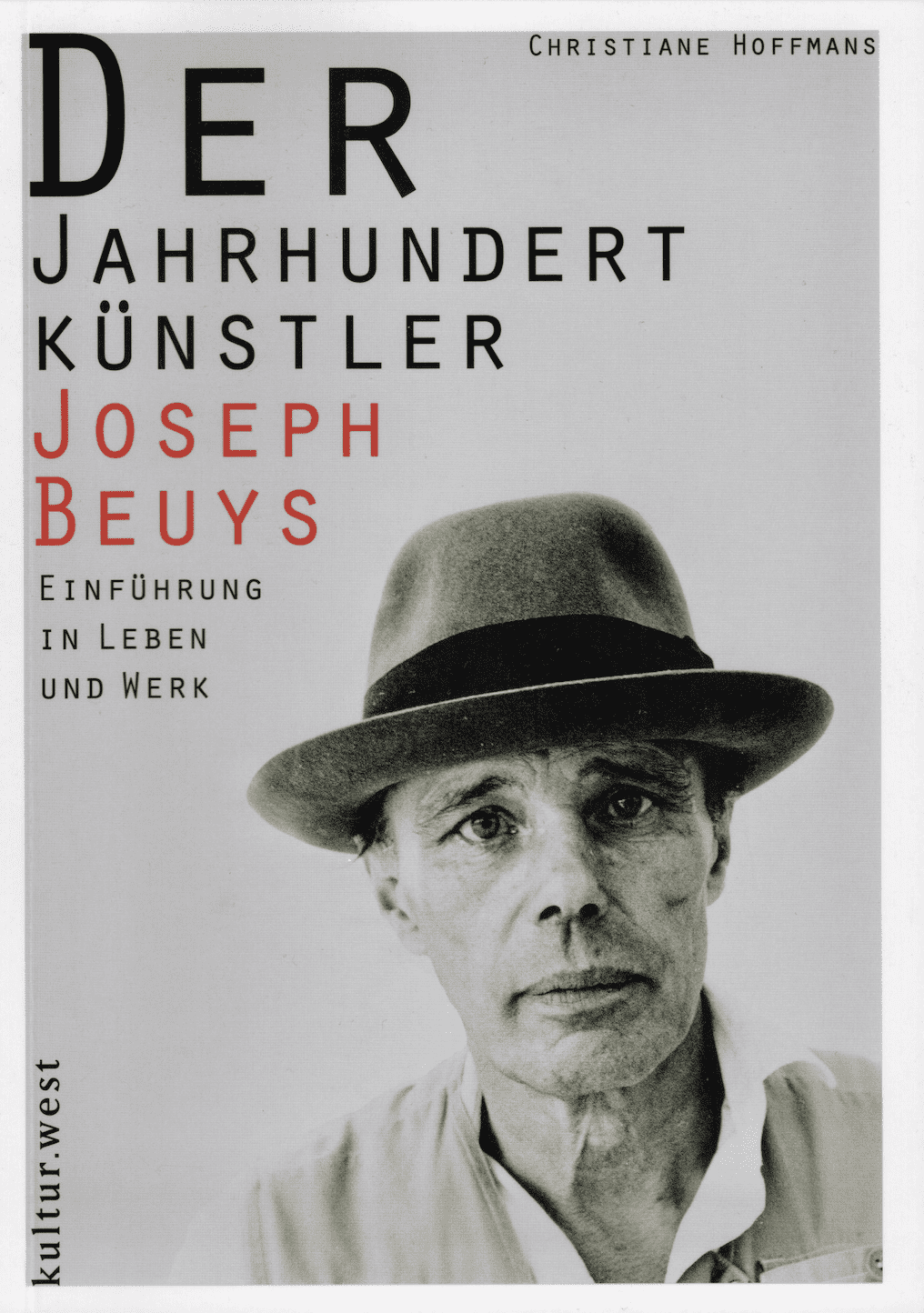Dass er in seiner Jugend Mitglied der Hitlerjugend war (wie nach 1939 rund 85 Prozent aller Jugendlichen), macht Joseph Beuys (1921–1986) ebenso wenig zum NS-Parteigänger wie sein Einsatz als Funker in der Luftwaffe. Nach 1945 nahm er allerdings an Kameradschaftsabenden seiner Stuka-Einheit teil und hat sich nie explizit von dieser Zeit distanziert. Kritiker wie Hans Peter Riegel werfen Beuys deshalb vor, eine „Blut-und-Boden-Gesinnung“ gepflegt zu haben. Eine Sichtweise, der Beuys-Weggefährten wie Klaus Staeck vehement widersprechen.
Angela Steffen, Volontärin am Museum Schloss Moyland, das in einem eigenen Archiv Werk und Wirken des wohl einflussreichsten deutschen Künstlers im 29. Jahrhundert umfassend dokumentiert, will die kontrovers geführte Debatte auf eine solide faktische Grundlage stellen. Im Zuge ihres „Forschungsvolontariats Kunstmuseen NRW“ hat Steffen das Sammlungs- und Archivgut ausgewertet.

Ihre Recherchen sind in die Präsentation „Joseph Beuys und der Nationalsozialismus – Ein Laborraum“ eingeflossen. Neben rund 90 Kunstwerken und Fotografien aus der Sammlung des Museums zeigt die Schau multimedial aufbereitete Informationen über die Jugend von Joseph Beuys und seine Zeit als Soldat. Eine eigene Ausstellung innerhalb der Ausstellung gilt der Beteiligung des Künstlers am 1957 ausgeschriebenen Wettbewerb für ein Mahnmal im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Zum Informationsangebot gehören schließlich auch Interviews mit Beuys-Forscher*innen sowie mit seinen Schüler*innen und Student*innen.
Der Mahnmal-Entwurf markiert eine Zäsur im Werk des Künstlers. Er steht deshalb im Zentrum des Laborraums. Dabei wendet das Projekt den Blick in zwei Richtungen: zurück auf Werke, die Beuys während des Krieges und in der Nachkriegszeit geschaffen hat, und nach vorn in die 1960er bis 1980er Jahre, als sich der Künstler wiederholt mit dem Zweiten Weltkrieg, Auschwitz und der Frage nach einer deutschen Kollektivschuld befasste.